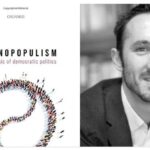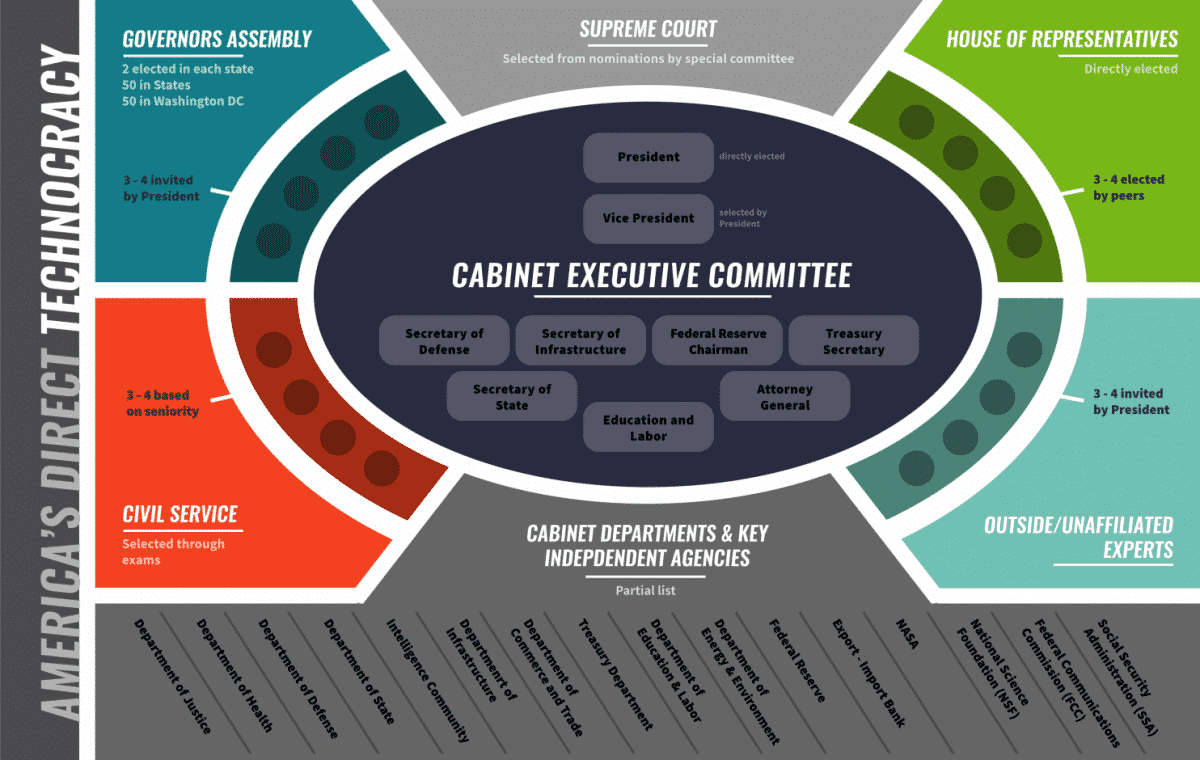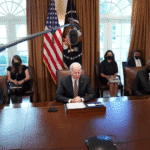Die Premium-Dienste von Technocracy News & Trends sind nur für Premium Access-Mitglieder verfügbar. Hör zu!
Weitere Artikel: